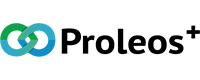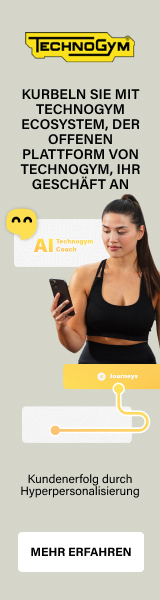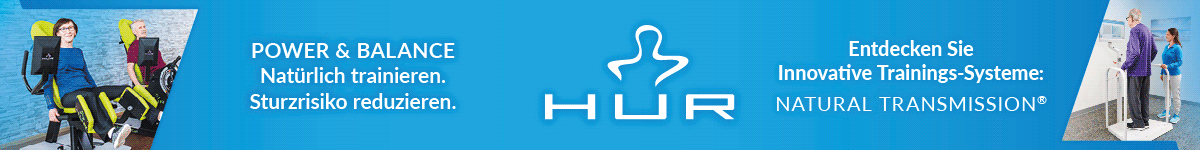Szene & Events
Zur Eventübersicht03.09.2021
Step-by-step zur Systemrelevanz

©
Teil 1: Die Veränderung beginnt im Kopf
Systemrelevanz – ein Wort, das Wertigkeit und Notwendigkeit bedeutet. Bereits in der Folge der Finanzkrise 2007 galten viele Banken als „too big to fail“ und wurden staatlich unterstützt. Wie erreicht die Fitness-Branche in dieser Krise nun einen Stellenwert, um ebenso wertgeschätzt zu werden?
Wobei es heutzutage gar nicht mehr um die staatliche Unterstützung eines Unternehmens geht, um weiter existieren zu können, sondern schlichtweg darum, überhaupt die Dienstleistungen weiter anbieten zu dürfen.
Schließung vs. Öffnung
Während Fitness-Studios mit dem 1. Lockdown geschlossen wurden, konnten Therapieeinrichtungen weiter geöffnet bleiben. Patienten, denen vom Arzt Krankengymnastik am Gerät (KGG) verschrieben wurde, hatten die Möglichkeit, in der Therapiepraxis ihr Training fortzuführen. Grund: Mit dem Rezept war das Training medizinisch notwendig.
Die Fitness-Studios hingegen waren das letzte Glied in der Kette, das wieder öffnen durfte – ungeachtet der vielen ausgereiften Hygienekonzepte, die erarbeitet worden waren. Fitness wurde nicht als systemrelevant eingestuft, weil die Branche sich im Freizeitsektor positioniert hatte, auf gleicher Ebene wie Theater, Kinos oder Hallenbäder. Freizeitaktivitäten, auf die man in Pandemie-Zeiten verzichten konnte – nicht relevant für unser gesellschaftliches System. So die Meinung der Gesetzgeber.
In einer neuen Serie wollen wir Ihnen Schritt für Schritt vorstellen, wie sich Fitness-Studios systemrelevant positionieren können. Hier als Erstes ein Überblick, welche einzelne Aspekte in Betracht gezogen werden müssen, um Fitness-Studios als Dienstleister der Gesundheit krisensicher aufzustellen. Wie kann man dem entgegentreten? Wie können sich Fitness-Studios aufstellen, um geöffnet zu bleiben, sollte die Pandemie nochmals ihre Fratze zeigen?
Fragen, die sich der Branchen-Experten Markus Sobau, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Consularis, stellte. Er beschäftigt sich aktuell sehr eingehend mit diesem Thema.
Mentale Vorbereitung auf die Veränderung
 Markus Sobau fordert im ersten Schritt eine inhaltliche Öffnung. Die Betreiber sind damit konfrontiert, gewohnte Bahnen zu verlassen und sich auf ein komplett neues Terrain einzulassen. Hierzu ist es notwendig sich eingehend zu informieren, bevor dann gedanklich die Änderung vollzogen wird. Das verlangt eine veränderte Wahrnehmung.
Markus Sobau fordert im ersten Schritt eine inhaltliche Öffnung. Die Betreiber sind damit konfrontiert, gewohnte Bahnen zu verlassen und sich auf ein komplett neues Terrain einzulassen. Hierzu ist es notwendig sich eingehend zu informieren, bevor dann gedanklich die Änderung vollzogen wird. Das verlangt eine veränderte Wahrnehmung.
„Die Veränderung beginnt im Kopf“, so bringt er das auf den Punkt. Ziel der Fitness-Studios muss es sein, nicht mehr freizeitorientiert zu denken, sondern sich als Gesundheitsdienstleister präsentieren zu wollen. „Erst wenn ich mich im Kopf dazu entschieden habe, folgt die Konzeption eines Masterplans, wie ich das umsetzen kann.“ Der Gesundheitsdienstleister sei ein Gesundheitsberuf, der Fitness-Studio-Betreiber sei ein „Freizeitsport-Beruf“, so Sobau.
Erst wenn der Studiobetreiber selbst die Wahrnehmung verändert habe, könne er planen, sich Gedanken über die einzelnen Schritte machen und dann in die Realisierung gehen.
Sichtbare Maßnahmen für alle
„Das fängt meiner Meinung nach nicht mit der Bereitstellung von Räumen für eine Physiotherapie-Praxis an, sondern indem ich schon im Fitness-Bereich andere Maßstäbe setze.“ Dies untermauert nach außen erkenntlich,dass sich das Fitness-Studio zum Gesundheitsdienstleister entwickelt. So sind zum Beispiel die unterschiedlichen Vorgaben bezüglich der Hygiene zu beachten.
Auch die Mitglieder des Fitness-Studios sollen die Veränderung bemerken. Banner und Vorträge sind ein Weg, diesen Wandel nach außen zu tragen. Die therapeutische Praxis erscheint dann als logische Konsequenz der eingeschlagenen Entwicklung. Die Potenzialen des 2. Gesundheitsmarktes spielen hier den Anbietern in die Hand, zumal Gesundheit, Gesunderhaltung angesichts der erfahrenen, durch Corona hervorgerufenen Wahrnehmung von Vulnerabilität an Bedeutung gewinnt.
Fazit: Auch wirtschaftlich interessant
Markus Sobau konzentriert sich in seinen Ausführungen zwar auf die Systemrelevanz mit dem Ziel, dass Fitness-Studios Pandemie bedingt keine Schließung mehr befürchten müssten. Doch einen kleinen, nicht unerheblichen Nebeneffekt bringt er trotzdem noch zur Sprache: die Wirtschaftlichkeit eines solchen Konzeptes.
Er rechnet vor: Je nach Zeittaktung und Behandlungsthema können pro Therapie-Mitarbeiter in Vollzeit im Jahr 80.000 bis 100.000 Euro Einnahmen generiert werden. Dem steht ein Jahresgehalt von 35.000 Euro bis 40.000 Euro brutto gegenüber. Markus Sobau erklärt auch, wie er auf diese Zahlen kommt. Nachweislich lag 2015/2016 das durchschnittliche Monatsgehalt eines Physiotherapeuten bei ca. 2.500 Euro. Im Jahr also ca. 30.000 Euro.
Der jährliche Durchschnittsertrag einer Praxis bei 30- minütiger Behandlungszeit, einem durchschnittlichen Leistungsspektrum der Therapie lag bei 60.000 bis 65.000 Euro. 2021 liegt das durchschnittliche Monatsgehalt eines Physiotherapeuten bei 3.000 Euro brutto, ca. 36.000 Euro im Jahr. Der Umsatz durch höhere Preise und kürzeren Behandlungszeiten stieg auf 80.000 bis 100.000 Euro.
Der Gewinn pro Mitarbeiter hat sich so gesehen in den letzten Jahren verdoppelt. So schlussfolgert er: „Die Physiotherapie-Praxis bringt nicht nur Imagegewinn, Patienten und Mitglieder, sondern man kann damit als Unternehmer auch Geld verdienen!“
Reinhild Karasek
Die Planung für den Change
Das Grundgerüst skizziert Markus Sobau wie folgt:
- 1. Ausgangsbasis: Um offen zu bleiben, muss ich etwas anbieten, was medizinisch notwendig ist.
- 2. Problem: Wie schaffe ich es, Gerätetraining so zu verändern, dass ich es während eines Lockdowns anbieten darf?
- 3. Mögliche Lösung: weg vom Freizeitsport hin zum Gesundheitsdienstleister.
Möglicher Lösungsweg Step-by-Step
Die einzelnen Schritte auf dem Lösungsweg würden optimalerweise nach Markus Sobau so aussehen:
- 1. Physiotherapie-Praxis an das Studio räumlich angliedern, anbauen, umgestalten oder einbauen.
- 2. Fachliche Leitung, d.h. einen Physiotherapeuten einstellen.
- 3. Der Physiotherapeut mit Zusatzqualifikation sektoraler Heilpraktiker kann selbst Privatrezepte ausstellen, also eine medizinisch notwendige Therapie verschreiben.
- 4. Entsprechende Angebote wie Präventionskurse, KGG oder T-Rena implementieren.
- 5. Jedes Mitglied kann in der eigenen Physiotherapie behandelt werden, was Kundenbindung verstärkt. – und umgekehrt: Patienten wird ermöglicht, im Anschluss an die Therapie als Mitglied im Studio das Gesundheitstraining fortsetzen.
Tipp von Markus Sobau
Zu beachten sind spezielle Regelungen im Heilmittelbereich, die den Praxisalltag bestimmen. Angefangen von den Voraussetzungen, die eine Praxis für eine GKV-Zulassung erfüllen muss sowie die Unterschiede in der Zulassung als Privatpraxis. Von den Abrechnungsmodalitäten über die Geräteausstattung bis hin zu räumlichen Auflagen und das Heilmittelwerbegesetz, das manchem Marketinggedanken Einhalt gebietet – es gibt viele Unterschiede, die zu meistern sind.
Auf diese einzelnen Punkte wollen wir im Laufe unserer Serie in den nächsten Ausgaben eingehen.
‹ Zurück
Ernährung & Wellness
 24.01.2026
Neues digitales Programm für nachhaltiges Abnehmen
myshape
24.01.2026
Neues digitales Programm für nachhaltiges Abnehmen
myshape
 20.01.2026
Expansion nach Frankreich
RelaxSensation verkündet Vertriebspartnerschaft
20.01.2026
Expansion nach Frankreich
RelaxSensation verkündet Vertriebspartnerschaft
 16.01.2026
Warum Neujahresvorsätze fast immer scheitern
Der Jahreswechsel aus der Perspektive der Entscheidungspsychologie
16.01.2026
Warum Neujahresvorsätze fast immer scheitern
Der Jahreswechsel aus der Perspektive der Entscheidungspsychologie
 15.01.2026
Neuer Gesundheitsplayer entsteht
Playlist und EGYM fusionieren
15.01.2026
Neuer Gesundheitsplayer entsteht
Playlist und EGYM fusionieren