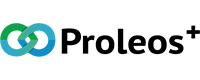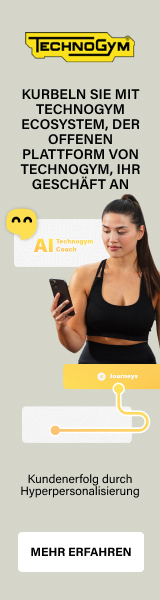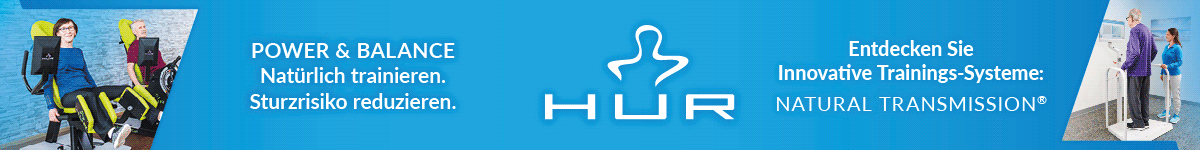Training
27.03.2025
Chancen nutzen, rechtliche Fallstricke beachten

©
Die klassische Physiotherapiepraxis steht vor einer spannenden Entwicklung: Neben den kassenfinanzierten Behandlungen gewinnen Selbstzahlerangebote zunehmend an Bedeutung. Zusätzliche Einnahmequellen, flexiblere Behandlungsmöglichkeiten und ein erweitertes Leistungsspektrum locken – doch wer diesen Weg einschlagen will, muss auch rechtliche Fallstricke im Blick behalten. Wie gelingt die Einführung eines Selbstzahlerbereichs, ohne gegen gesetzliche Vorgaben zu verstoßen? Welche Maßnahmen sorgen für Rechtssicherheit und Transparenz? Dieser Artikel gibt Ihnen einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Fallstricke, die Sie bei Selbstzahlern beachten müssen.
Als Selbstzahler gelten alle Personen, die eine (physiotherapeutische) Behandlung in Anspruch nehmen, für die sie keine ärztliche Verordnung haben bzw. die nicht von einem Arzt verordnet werden kann.
Fallstrick 1: Abgrenzung zu Heilbehandlungen
Ein entscheidender Punkt ist die Abgrenzung zwischen medizinisch notwendigen Heilbehandlungen und Selbstzahlerleistungen. Benennt ein Kunde Beschwerden, die eine ärztliche Diagnostik erfordern, wahrscheinlich erscheinen lassen oder auf eine Krankheit hindeuten, dann dürfen Sie diesen nicht im Rahmen von Selbstzahlerleistungen behandeln. Ohne eine ärztliche Verordnung dürfen Sie keine therapeutischen Leistungen erbringen, es sei denn, Sie verfügen über die Zusatzqualifikation als sektoraler Heilpraktiker für Physiotherapie.
Reine Selbstzahlerleistungen umfassen ausschließlich Präventionsangebote, Wohlfühl- bzw. Wellnessbehandlungen oder bestimmte Zusatzleistungen wie z.B. Fango und Taping. Eine klare Kommunikation gegenüber den Patienten ist hier essenziell, um Missverständnisse zu vermeiden.
Fallstrick 2: Trennung Praxis und Gewerbe
Wird der Selbstzahlerbereich in einer Praxis betrieben, die auch gesetzlich Versicherte behandelt, muss eine räumliche und organisatorische Trennung gegeben sein. Gemäß den Bestimmungen in den Rahmenverträgen der GKV (Nr. 11 Abs. 5) muss gewährleistet sein, dass wenn während der Öffnungszeiten weitere Leistungen außerhalb der Heilmitteldisziplin angeboten werden, die oder der Versicherte, die für diese Leistungen separat vorzuhaltenden Räume oder Bereiche nicht betreten muss.
Wenn der gesetzlich versicherte Patient für die Heilmittelabgabe die Räumlichkeiten, in denen Selbstzahlerleistungen erbracht werden, nicht betreten soll, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass sichergestellt werden muss, dass es entweder eine räumliche oder zeitliche Trennung zwischen Kassenpatienten und Selbstzahler gibt.
Zeitliche Trennung uns separater Check-in
Das Anbieten von Zusatzleistungen wie Fitnesskurs oder Gerätetraining für Selbstzahler kann als gewerbliche Tätigkeit eingestuft werden. Um mögliche Probleme mit der Krankenkasse zu vermeiden, sollten diese Zusatzleistungen beispielsweise außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten der Praxis oder in separaten Räumlichkeiten, in denen keine gesetzlich versicherten Patienten behandelt werden, angeboten werden. Ebenso sollte für Selbstzahler ein separater Check-in und ein eigenes Mitgliedersystem eingerichtet werden. Lange Zeit gab es strenge Anforderungen hinsichtlich der baulichen Trennung, bis hin zur Forderung nach separaten Eingängen. Mittlerweile wurden diese Regelungen gelockert und ein gemeinsamer Eingang, Toiletten und Wartebereich sind möglich.
Fallstrick 3: Werbung und Heimittelwerbegesetz
Die Werbung für Angebote im Gesundheitsbereich unterliegt dem Heilmittelwerbegesetz (HWG) und dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Die Vorschriften des HWG müssen immer dann beachtet werden, wenn die Werbung einen Bezug zur Linderung von Leiden herstellt. Irreführende Aussagen sowie nicht wissenschaftlich belegte Heilversprechen sind verboten. Auch Wirkversprechen, beispielsweise „Durch Taping wird die Beweglichkeit verbessert“, können zu Abmahnungen führen. Achten Sie daher darauf, Ihre Werbebotschaften rechtssicher zu formulieren. Wichtig ist zudem eine transparente Preisgestaltung. Kundinnen und Kunden müssen klar erkennen können, welche Leistungen sie privat zahlen müssen und welche möglicherweise durch Krankenkassen erstattungsfähig sind. Unklare oder missverständliche Darstellungen können nicht nur wettbewerbsrechtliche Probleme verursachen, sondern auch zu Unzufriedenheit bei der Kundschaft führen.
Fallstrick 4: Datenschutz und Einwilligung
Als Physiotherapeut verarbeiten Sie tagtäglich personenbezogene Daten und auch besondere personenbezogene Daten in Form von Gesundheitsdaten. Ohne diese können sie ihre Leistung gar nicht anbieten. Die Datenerhebung und -verarbeitung hat ihre rechtliche Grundlage daher im Patientenvertrag. Eine Einwilligung ist daher nicht zwingend erforderlich. Nichtsdestotrotz beugt eine Datenschutzinformation Missverständnissen vor und schafft Vertrauen.
Auch im Selbstzahlerbereich werden personenbezogene Daten verarbeitet. Als Anbieter eines Selbstzahlerbereichs sind Sie jedoch nicht im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zur Datenverarbeitung verpflichtet, sodass Sie eine gesonderte Datenschutzinformation samt Einwilligung vom Selbstzahlerkunden benötigen. Gut zu wissen: Bitte beachten Sie, dass Sie die in der Praxis erhobenen Daten nicht automatisch für die Selbststzahlerleistungen nutzen dürfen. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn der Kunde Ihnen die Daten erneut zur Verfügung stellt (z.B. eigener Vertrag und Anamnese im Selbstzahlerbereich) oder die ausdrückliche Einwilligung zur Übernahme erteilt.
Fallstrick 5: Umsatzsteuer und Abrechnung
Eine Steuerbefreiung bei Selbstzahlerleistungen ist nur dann möglich, wenn die Leistung eine medizinisch notwendige Heilbehandlung darstellt und der physiotherapeutische Zweck nachweisbar ist. Das Finanzgericht Düsseldorf (Urteil vom 16.04.2021, Az: 1 K 2249/17 U) hat dazu entschieden, dass die Behandlungen von Selbstzahlern ebenfalls umsatzsteuerfrei sind, wenn bereits vor der Anschlussbehandlung eine ärztliche Verordnung vorlag oder wenn im Nachgang die Patienten wegen derselben Diagnose eine erneute ärztliche Verordnung vorlegen.
Gut zu wissen: Dies gilt jedoch nicht für Nebenleistungen, für die es keine Verordnung gibt. Sie sind nicht von der Umsatzsteuer befreit. Zu diesen Leistungen zählen z.B. Taping,Wärme- oder Kältetherapie genauso wie Präventionskurse und Gerätetraining
Fallstrick 6: Verträge und Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Da der gewerbliche Selbstzahlertrainingsbereich unabhängig von der Praxis sein muss, bedarf es auch eines gesonderten Mitgliedsvertrags und eigener AGB. Darin sollten Regelungen zu Vertragslaufzeit, Kündigung und Haftung enthalten sein. Besonders im Bereich Haftung gibt es gesetzliche Einschränkungen: Ein pauschaler Haftungsausschluss ist nicht möglich, da Verbraucher nicht unangemessen benachteiligt werden dürfen. Auch Klauseln wie „Training auf eigene Gefahr“ sind unwirksam, da sie eine vollständige Haftungsfreistellung beinhalten.
Zulässig sind hingegen Haftungsbegrenzungen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit oder spezifische Regelungen für Schäden durch unsachgemäße Nutzung von Trainingsgeräten. Eine sorgfältige Anamnese sowie ein Health-Disclaimer können zusätzlich zur Absicherung beitragen.
Fazit
Selbstzahlerleistungen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Praxis wirtschaftlich attraktiver aufzustellen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern jedoch eine sorgfältige Planung. Mit einer klaren Trennung von kassenfinanzierten Leistungen, einer korrekten Werbestrategie, datenschutzkonformen Abläufen sowie einer umsatzsteuerrechtlich sauberen Abrechnung legen Sie den Grundstein für einen erfolgreichen und rechtskonformen Betrieb. Wenn Sie sich frühzeitig mit den rechtlichen Anforderungen auseinandersetzen, können Sie sich erfolgreich und rechtssicher am Markt positionieren.
Julia Ruch
Die Autorin
Julia Ruch ist Anwältin für die Fitness- & Gesundheitsbranche und hat sich mit ihrer Kollegin Astrid Bemfert auf die Beratung von Fitnessstudios, Personal Trainern und Physio-Praxen spezialisiert, damit sich diese erfolgreich und rechtssicher am Markt positionieren können. Julia Ruch ist Inhaberin der aktivKANZLEI: www.aktivkanzlei.de
‹ Zurück
Therapie
 26.01.2026
Gut vorbereitet in die Telematikinfrastruktur
So gelingt der TI-Anschluss in der Physiotherapie, Teil 2
26.01.2026
Gut vorbereitet in die Telematikinfrastruktur
So gelingt der TI-Anschluss in der Physiotherapie, Teil 2
 23.01.2026
Anfassen, Fühlen, Entspannen
Relax Sensation auf der therapro 2026
23.01.2026
Anfassen, Fühlen, Entspannen
Relax Sensation auf der therapro 2026
 22.01.2026
Zehn Jahre Masterstudium für den Gesundheitsmarkt
IST feiert Jubiläum
22.01.2026
Zehn Jahre Masterstudium für den Gesundheitsmarkt
IST feiert Jubiläum
 22.01.2026
FitLife Stage, therapro Cube, Mitmach-Area
therapro 2026: Highlights des Hallenprogramms
22.01.2026
FitLife Stage, therapro Cube, Mitmach-Area
therapro 2026: Highlights des Hallenprogramms